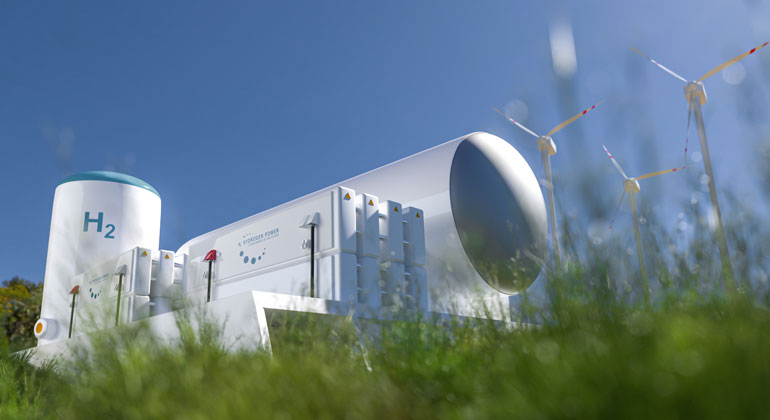Städte,
Gemeinden und Regionen spielen eine entscheidende Rolle, um die Ziele
der Schweizer Energiestrategie 2050 sowie des Pariser Klimaabkommens zu
erreichen. «EnergieSchweiz für Gemeinden» unterstützt sie beim Umsetzen
ihrer Klima- und Energieprojekte. Besonders engagierte Städte und
Gemeinden konnten sich 2021 erstmals als Front Runner bewerben.
Energeiaplus zeigt aus Anlass des Energietags 2023, welche Massnahmen die fünf Städte getroffen haben, die bei der ersten Ausschreibung ausgewählt wurden.
Den Zuschlag als Front Runner hatten 2021 die Städte Burgdorf, Schaffhausen, Thun, St. Gallen und Winterthur
erhalten. Alle fünf engagieren sich bereits länger im Bereich Energie
und Klima. Alle tragen auch das Label Energiestadt oder sind gar GOLD
zertifiziert. Diese Auszeichnung geht an Städte, welche ihre
Energieeffizienz stark verbessern und auf erneuerbare Energien setzen.
Die Städte verfügen zudem bereits über ein Smart-City-Konzept und einen
politischen Beschluss zur 2000-Watt-Gesellschaft oder zu CO2-Netto-Null.
Front
Runner sind die ambitioniertesten Städte und Gemeinden in Sachen
Energie- und Klimapolitik. Sie verfolgen bereits Smart-City- sowie
2000-Watt-/Netto-Null-Strategien und stimmen diese nun aufeinander ab.
Darauf aufbauend realisieren sie mehrere Umsetzungsprojekte: zum
Beispiel zu Mobilitäts-Sharing, Förderungen von Velos, Fernwärme oder
Bedienung von smarten Gebäuden.
Die Fördergelder betragen für die
Projekte der fünf Gemeinden zusammen circa 945’000 Franken. Die
Projektkosten belaufen sich insgesamt auf rund 2,9 Millionen Franken.
Front
Runner ist eine von vier Kategorien im Rahmen der Projektförderung
«EnergieSchweiz für Gemeinden». EnergieSchweiz wiederum ist das Programm
des Bundesamts für Energie (BFE), das mit freiwilligen Massnahmen
Energieeffizienz und erneuerbare Energien fördert.
Bei der zweiten
Ausschreibung 2023 erhielten die fünf Gemeinden Biel, Freiburg, Kriens,
Zug und Basel-Stadt den Zuschlag als Front Runner. Mehr dazu hier:
Ziel des Front-Runner-Programms
ist es, die bestehenden Smart-City-Initiativen mit den
energiepolitischen Beschlüssen der 2000-Watt- oder
Netto-Null-Gesellschaft zu verbinden und aufeinander abzustimmen. Um die
Strategien schon während den ersten Schritten sichtbar umzusetzen,
werden im Front Runner-Programm bis zu drei Umsetzungsprojekte gefördert
– zum Beispiel zu Mobilitäts-Sharing, Förderungen von Velos, Fernwärme
oder Bedienung von smarten Gebäuden.
Die Fördergelder betragen für
die Projekte der fünf Front Runner-Gemeinden von 2021 zusammen circa
945’000 Franken. Und was haben die Gemeinden mit dieser Unterstützung
umgesetzt?

Kehrichtentsorgung in Burgdorf
Zum Beispiel Burgdorf (rund 16’600 Einwohnende, Stand Ende 2022)
In
der Emmentaler Kleinstadt wurde 1996 die erste «Flanierzone», der
Prototyp für die Begegnungszone realisiert. Durch die dortige
Fachhochschule war Photovoltaik schon früh ein Thema. Seit 1999 trägt
Burgdorf das Label Energiestadt.
Wo zeigt sich Burgdorf nun konkret als Front Runner?
Flächendeckender Ausbau von Fernwärme bis 2030:
Die
ganze Stadt und Teile der angrenzenden Gemeinde Oberburg sollen mit
Fernwärme erschlossen werden – und dies nicht Stück für Stück, sondern
mit einer umfassenden Planung. Dies beinhaltet eine entsprechende
Überbauungsordnung. So sollen Burgdorferinnen und Burgdorfer mehr
Planungssicherheit beim Heizungsersatz erhalten.
Mit IoT Ressourceneinsatz optimieren:
Sensoren
übermitteln den Füllstand von öffentlichen Abfallcontainern,
Algorithmen berechnen die optimalen Leerungszeitpunkte und Fahrrouten.
Burgdorf verspricht sich davon mehr Effizienz und weniger CO2-Emissionen
beim Unterhalt und Betrieb der Abfallentsorgung.

Geteilte Mobilität Schaffhausen
Zum Beispiel Schaffhausen (Rund 38’000 Einwohnende, Stand Ende 2022)
Schaffhausen
ist Energiestadt der ersten Stunde: Als Gründungsmitglied von
Energiestadt ist die Stadt seit 1991 Trägerin des Labels und seit
mehreren Jahren Energiestadt GOLD.
Wo setzt Schaffhausen als Front Runner Akzente?
Bewirtschaftung von stadteigenen Gebäuden optimieren:
Mit
geeigneten Technologien und Systemen soll der Energieverbrauch
reduziert werden. Die Basis liefern Daten z.B. zu Heizungseinbau,
Energie- und Wasserverbrauch.
Sharehausen – geteilte Mobilität für nachhaltige Verkehrslösungen:
Schaffhausen setzt dabei auf die Erfahrungen anderer Städte.

Partizipativer Ansatz in Thun
Zum Beispiel g (rund 44’000 Einwohnende, Stand Ende 2022)
Seit
2010 ist Thun Energiestadt. Die Versorgung mit Fernwärme oder Anreize
für die Bevölkerung für umweltfreundliches Verhalten sind Massnahmen,
welche die Stadt verfolgt.
Wo zeichnet sich Thun als Front Runner aus?
Reallabor:
Vertreterinnen
und Vertreter aus Wirtschaft, öffentlicher Hand und Bevölkerung
entwickeln Pilotprojekte und neue Geschäftsmodelle rund um Netto-Null
und Smart City.
Heizungsersatz:
Die Stadt teilt das
Gebiet in Cluster mit ähnlichen Voraussetzungen ein. So sollen
Gebäudebesitzenden für den Umstieg auf ein erneuerbares System motiviert
werden. Mit clusterspezifischen Angeboten in Zusammenarbeit mit dem
lokalen Energieversorger soll die Umsetzung so einfacher werden.

Stadtwerke St. Gallen
Zum Beispiel St. Gallen (rund 83’000 Einwohnende, Stand Juni 2023)
Seit 2004 trägt die Ostschweizer Stadt das Label Energiestadt und ist ebenfalls GOLD zertifiziert.
Wo setzt St. Gallen als Front Runner an?
Pilotprojekt E-Ladestationen im Quartier:
Gemäss
dem städtischen Energiekonzept sollen 2050 vorwiegend Elektrofahrzeuge
in der Stadt unterwegs sein. Die Stadt testet nun, ob Bewohnerinnen und
Bewohner schneller auf Elektromobilität umsteigen, wenn man ihnen eine
Ladestation in der blauen Zone zur Verfügung stellt. Ziel ist, das
E-Ladenetz systematisch in der ganzen Stadt auszubauen.
Photovoltaik im Stadtgebiet ausbauen:
Die
Herausforderungen dabei: Was heisst das für die Netzstabilität? Wieviel
Strom muss die Stadt zusätzlich einkaufen? Wie verlässlich sind die
Wetterprognosen? Die Stadt will dabei auf «Deep Learning Algorithmen»
setzen, die dann auch für andere Bereiche nutzbar sein könnten – vom
Schneeräumdienst über die Verkehrsbetriebe bis zu den Stadtwerken.

Stadt Winterthur
Zum Beispiel Winterthur (rund 121’600 Einwohnende, Stand Ende 2022)
Seit
1999 ist die Stadt Winterthur Energiestadt. Die Stadt hat
beispielsweise 2019 ihre Beleuchtung auf intelligente LED-Technik
umgestellt, um den Strombedarf zu senken. Themen in Winterthur sind
weiter unter anderem die Nutzung von im Abfall enthaltener Energie zur
Strom- und Wärmeproduktion oder die Auswertung des Stromverbrauchs (wer
verbraucht wann wieviel Strom).
Was sind die Front Runner Massnahmen von Winterthur?
Start-Up-Förderung:
In
einer Online-Challenge wurden sechs Start-Ups ausgewählt, die sich mit
Klima und Energie auseinandersetzen. Es geht dabei um Bohrroboter für
Erdwärmepumpen, dezentrale Solarstromproduktion mittels Blockchain oder
energieeffiziente Biomasse. Die ZHAW unterstützt sie mit einem Coaching.
Eigenverbrauchsgemeinschaft hoch 2:
Bei
diesem Projekt sollen sich Firmen und Bewohnerinnen und Bewohner
zusammenschliessen, um Solarenergie zu produzieren und E-Fahrzeuge
gemeinsam zu nutzen. In drei unterschiedlichen Pilotarealen wird dies
getestet.
Die Projektförderung im Rahmen von
«EnergieSchweiz für Gemeinden» geht in die zweite Runde. 483 Städte und
Gemeinden aus allen Sprachregionen haben sich für die vier verschiedenen
Förderkategorien beworben. 444 erhielten den Zuschlag. Das heisst 21%
der gut 2100 Schweizer Städte und Gemeinden profitieren von der
Projektförderung und werden in den nächsten zwei Jahren Projekte für
mehr erneuerbare Energien und Energieeffizienz umsetzen. Hier geht’s zu
den ausgewählten Städten und Gemeinden.
Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
^^^ Nach oben